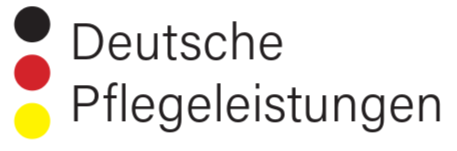Der Pflegegrad 5 ist der höchste Pflegegrad in Deutschland und wird Personen mit „schwerster Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung“ zuerkannt. Dies bedeutet, dass Betroffene in nahezu allen Bereichen ihres Lebens auf umfassende Hilfe angewiesen sind. Um den Pflegegrad 5 zu erhalten, muss ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) oder von Medicproof (bei Privatversicherten) erstellt werden, das die erhebliche Einschränkung der Selbstständigkeit bestätigt. Im Begutachtungssystem müssen mindestens 90 Punkte erreicht werden.
Definition
Der Pflegegrad 5 ist der höchste Pflegegrad, den der Medizinische Dienst (MD) bei Prüfung der Selbstständigkeit einer Person vergibt. Er zeigt die maximale körperliche, psychische und kognitive Beeinträchtigung eines Menschen auf. Ab 90 Punkten werden pflegebedürftige Personen in den Grad 5 eingestuft.
Voraussetzungen
Um den Pflegegrad 5 zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zunächst ist ein Antrag bei der zuständigen Pflegeversicherung erforderlich. Im Anschluss erfolgt eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof. Dabei wird der Grad der Selbstständigkeit des Antragstellers anhand des Neuen Begutachtungsassessments (NBA) beurteilt. Dieses Verfahren bewertet sechs verschiedene Module, darunter Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Verhalten, Selbstversorgung, Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen und Gestaltung des Alltagslebens. Eine Gesamtpunktzahl von 90 bis 100 ist notwendig, um Pflegegrad 5 zu erhalten. In besonderen Fällen, wie bei der Beeinträchtigung aller vier Gliedmaßen, kann auch bei niedrigerer Punktzahl Pflegegrad 5 zuerkannt werden.
II. Leistungen
Mit Pflegegrad 5 stehen Betroffenen verschiedene Leistungen zu, die je nach Bedarfslage individuell genutzt werden können. Ein zentraler Aspekt ist die Wahl zwischen häuslicher und stationärer Pflege, wobei die Pflegekasse unterschiedliche finanzielle Unterstützungen bietet. Bei häuslicher Pflege können Pflegebedürftige Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder eine Kombination aus beidem in Anspruch nehmen, um die Versorgung durch Angehörige oder professionelle Pflegedienste zu gewährleisten. Zusätzlich gibt es Entlastungsleistungen, Zuschüsse für Hilfsmittel und die Möglichkeit zur Wohnraumanpassung, um den Alltag zu erleichtern. Andererseits besteht die Option der vollstationären Pflege in einem Pflegeheim, bei der die Pflegekasse einen monatlichen Zuschuss leistet, während zusätzliche Kosten wie Unterkunft und Verpflegung selbst getragen werden müssen. Unabhängig von der gewählten Pflegeform haben Pflegebedürftige Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung, um ihre Lebensqualität und soziale Teilhabe zu fördern.
Überblick
Pflegegrad 5 ist die höchste Stufe der Pflegebedürftigkeit in Deutschland und wird Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung zuerkannt. Umfassende Unterstützung ist in diesem Fall unerlässlich, um den Alltag zu bewältigen. Die Pflegekasse bietet hierfür ein breites Spektrum an Leistungen, die sowohl finanzielle Hilfen als auch Sachleistungen umfassen, um die häusliche oder stationäre Pflege zu gewährleisten und pflegende Angehörige zu entlasten. Dieser Artikel gibt einen detaillierten Überblick über die Definition, Voraussetzungen und Leistungen, die mit Pflegegrad 5 verbunden sind.
Geld- und Sachleistungen
Pflegebedürftige mit Pflegegrad 5 haben Anspruch auf vielfältige Geld- und Sachleistungen, die darauf abzielen, ihre Versorgung und Lebensqualität zu verbessern. Zu den wichtigsten Leistungen gehören das Pflegegeld, das monatlich zur freien Verfügung steht und im Jahr 2025 999 Euro beträgt, sowie die Pflegesachleistungen, die für die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes vorgesehen sind und sich auf 2.299 Euro monatlich belaufen. Diese Leistungen können auch kombiniert werden, um eine flexible und bedarfsgerechte Versorgung sicherzustellen. Darüber hinaus gibt es Ansprüche auf Pflegehilfsmittel zum Verbrauch, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag und Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen.
Kombinationsleistungen
Kombinationsleistungen ermöglichen es Pflegebedürftigen, sowohl Pflegegeld als auch Pflegesachleistungen anteilig zu beziehen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die pflegerische Versorgung sowohl durch Angehörige als auch durch einen ambulanten Pflegedienst sichergestellt wird. Der Anspruch auf Pflegegeld reduziert sich dabei um den Prozentsatz der ausgeschöpften Pflegesachleistung. Je höher die Kosten für den Pflegedienst sind, desto geringer fällt das Pflegegeld aus und umgekehrt. Ein Beispiel: Bei Pflegegrad 5 erhält man entweder 2.299 € Pflegesachleistungen oder 999 € Pflegegeld monatlich. Wenn der Pflegedienst 2.069,10 € abrechnet, was 90 % der Pflegesachleistungen entspricht, verbleiben 10 % des maximalen Betrags. Über die Kombinationsleistung können dann noch 99,90 € Pflegegeld beantragt werden.
III. Häusliche Pflege
Die häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 stellt besondere Anforderungen an die Organisation und die beteiligten Personen. Oftmals sind pflegende Angehörige stark gefordert, da Menschen mit Pflegegrad 5 einen hohen Bedarf an Unterstützung haben. Es ist wichtig, sich über die verschiedenen Leistungen und Möglichkeiten der Unterstützung zu informieren und diese in Anspruch zu nehmen, um die Pflege zu Hause bestmöglich zu gestalten. Dazu gehören unter anderem die Organisation der Grundpflege, die Unterstützung bei der Mobilität und die Gestaltung des Alltags. Auch die Entlastung der pflegenden Angehörigen spielt eine wichtige Rolle, um eine langfristige und qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen.
Organisation
Die Organisation der häuslichen Pflege bei Pflegegrad 5 erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination, um den komplexen Bedürfnissen des Pflegebedürftigen gerecht zu werden. Es ist wichtig, ein Netzwerk aus professionellen Dienstleistern, wie ambulanten Pflegediensten, Therapeuten und Ärzten, sowie persönlichen Helfern und Familienmitgliedern aufzubauen. Klare Absprachen und Verantwortlichkeiten sind essenziell, um eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen. Zudem sollten pflegende Angehörige darauf achten, ihre eigenen Ressourcen zu schonen und Entlastungsangebote, wie beispielsweise die Verhinderungspflege oder den Entlastungsbetrag, in Anspruch zu nehmen, um eine langfristige und nachhaltige Pflege zu gewährleisten.
Leistungen im Detail
Bei Pflegegrad 5 ist die umfassende Unterstützung durch Angehörige und/oder einen ambulanten Pflegedienst von großer Bedeutung. Um die pflegenden Angehörigen zu entlasten und die bestmögliche Versorgung sicherzustellen, stehen verschiedene Leistungen zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem das Pflegegeld, welches zur freien Verfügung steht, sowie die Möglichkeit, Pflegesachleistungen für die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes zu nutzen. Auch die Tages- und Nachtpflege kann eine wertvolle Unterstützung sein, um den Pflegebedürftigen tagsüber oder nachts in einer professionellen Einrichtung betreuen zu lassen. Zudem gibt es den Entlastungsbetrag, der für zusätzliche Betreuungsangebote und haushaltsnahe Dienstleistungen eingesetzt werden kann.
IV. Stationäre Pflege
Bei Pflegegrad 5 erfolgt die Versorgung entweder zu Hause oder in einer stationären Einrichtung. Bei einer stationären Unterbringung übernimmt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten. Im Jahr 2025 beträgt dieser Zuschuss 2.096 Euro monatlich. Dieser Betrag deckt jedoch nicht alle anfallenden Kosten ab. Zusätzliche Kosten entstehen für Unterkunft, Verpflegung und gegebenenfalls Investitionskosten, die vom Pflegebedürftigen selbst getragen werden müssen. Es ist ratsam, sich vorab über die genauen Kosten der jeweiligen Einrichtung zu informieren, da diese variieren können.
Kosten
Die Kosten für eine vollstationäre Pflege im Pflegeheim setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Die Pflegeversicherung übernimmt bei Pflegegrad 5 einen monatlichen Zuschuss von 2.096 Euro. Reichen diese Leistungen nicht aus, um die pflegebedingten Aufwendungen zu decken, muss der Pflegebedürftige einen Eigenanteil leisten. Seit 2017 gilt ein einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) für die Pflegegrade 2 bis 5, wodurch Betroffene im Pflegegrad 5 nicht mehr mehr zahlen als beispielsweise im Pflegegrad 2. Zusätzlich zum pflegebedingten Eigenanteil fallen weitere Kosten für Unterkunft, Verpflegung und gegebenenfalls Investitionskosten an. Um steigende Pflegekosten abzufedern, zahlt die Pflegeversicherung einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil, der mit der Dauer der vollstationären Pflege steigt: Im ersten Jahr 15 Prozent, im zweiten 30 Prozent, im dritten 50 Prozent und ab dem vierten Jahr 75 Prozent.
Auswahl des Pflegeheims
Bei der Auswahl eines Pflegeheims sollten mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Einrichtung den Bedürfnissen des Pflegebedürftigen entspricht. Es ist ratsam, Leistungs- und Preisvergleichslisten der Pflegekassen einzusehen, die einen guten Überblick über zugelassene Pflegeheime bieten. Die Kosten für Verpflegung, Unterkunft, Investitionen und Komfortleistungen können je nach Einrichtung variieren, daher ist eine ausführliche Information im Vorfeld wichtig. Neben den genannten Aspekten sollte auch auf die Qualität der Pflege, die Qualifikation des Personals und das Vorhandensein von Spezialisierungen, wie beispielsweise für Demenzkranke, geachtet werden. Eine angenehme und barrierefreie Umgebung sowie die Lage und Erreichbarkeit des Heims für Angehörige sind ebenfalls wichtige Kriterien.
V. Begutachtung
Die Feststellung des Pflegegrads 5 erfolgt durch eine Begutachtung. Hierbei werden Kriterien wie Mobilität, kognitive Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Selbstversorgung und die Fähigkeit, mit krankheitsbedingten Anforderungen umzugehen, berücksichtigt. Eine umfassende Vorbereitung auf diese Begutachtung ist entscheidend. Dazu gehört das Sammeln relevanter medizinischer Unterlagen und das Führen eines Pflegetagebuchs, um den tatsächlichen Pflegebedarf zu dokumentieren. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über die Begutachtungskriterien zu informieren und gegebenenfalls eine Pflegeberatung in Anspruch zu nehmen, um optimal vorbereitet zu sein.
Kriterien
Um den Pflegegrad 5 zu erhalten, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, die im Rahmen einer Pflegebegutachtung überprüft werden. Diese Kriterien umfassen sechs Lebensbereiche, die unterschiedlich gewichtet werden: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Eine Gesamtpunktzahl von 90 bis 100 Punkten in der Begutachtung ist erforderlich, um Pflegegrad 5 zu erhalten. Diese hohe Punktzahl spiegelt den umfassenden Unterstützungsbedarf der betroffenen Person wider.
Vorbereitung
Die Vorbereitung auf die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) ist entscheidend, um den Pflegegrad 5 zu erhalten. Es ist ratsam, ein Pflegetagebuch zu führen, in dem alle relevanten pflegerischen Maßnahmen und Einschränkungen dokumentiert werden. Dieses dient als Nachweis und Gedächtnisstütze für den Gutachtertermin. Angehörige sollten bei der Begutachtung anwesend sein, um die Situation aus ihrer Sicht zu schildern. Es ist wichtig, den Alltag realistisch darzustellen und keine Beschönigung vorzunehmen, damit der tatsächliche Pflegebedarf korrekt erfasst wird.
VI. Widerspruch
Ein Widerspruch gegen den Pflegegradbescheid ist möglich, wenn Sie mit der Entscheidung der Pflegekasse nicht einverstanden sind. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Pflegebedarf höher eingestuft werden sollte. Ein häufiger Grund für einen Widerspruch ist die Fehleinschätzung des Gutachters vom Medizinischen Dienst (MD). Es ist wichtig, den Widerspruch schriftlich und innerhalb einer bestimmten Frist einzureichen. Im Widerspruch sollten Sie die Gründe für Ihre Beanstandung detailliert darlegen und gegebenenfalls zusätzliche medizinische Unterlagen oder Gutachten beifügen. Ein formloser Brief ist ausreichend, es empfiehlt sich jedoch, ein Muster zu verwenden und den Widerspruch per Einschreiben zu versenden, um den fristgerechten Eingang nachweisen zu können.
Gründe
Es gibt verschiedene Gründe, die zu einem Widerspruch gegen die Entscheidung des Medizinischen Dienstes führen können. Häufig fühlen sich pflegende Angehörige nicht ausreichend gehört oder sind der Meinung, dass die Begutachtung die tatsächliche Pflegesituation nicht korrekt widerspiegelt. Auch eine fehlerhafte Bewertung der Selbstständigkeit oder das Übersehen wichtiger Aspekte können Anlass für einen Widerspruch sein. Ein weiterer Grund kann sein, dass sich der Gesundheitszustand des Pflegebedürftigen kurz nach der Begutachtung verschlechtert hat.
Vorgehen
Etwa jeder dritte Antrag auf einen Pflegegrad wird abgelehnt oder es wird ein Pflegegrad berechnet, der unerwartet niedrig ist. In beiden Fällen sollten Sie innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Ablehnungsbescheides Widerspruch einlegen. Erledigen Sie das immer schriftlich – per Einschreiben mit Rückschein.
Prüfen Sie dazu zunächst das der Ablehnung beigefügte Gutachten und gehen Sie alle dort aufgelisteten Punkte durch. Folgende Überlegungen helfen außerdem: War der Pflegebedürftige am Tag der Begutachtung ungewöhnlich fit und entsprach dieser Tag möglicherweise nicht dem durchschnittlichen Pflegealltag? Wurden alle Sachverhalte korrekt erfasst oder fehlen einige Punkte? Halten Sie alles schriftlich fest, was Ihnen auffällt oder diesbezüglich in den Sinn kommt. So vergessen Sie nichts, wenn Sie in den Widerspruch gehen.
Lassen Sie sich am besten auch von einem Pflegeberatungsdienst unterstützen. Solche Beratungsstellen sind speziell auf diese Fälle spezialisiert und kennen alle Tricks und Kniffe. So erhöhen Sie die Chancen, dass der Antrag auf Pflegeleistungen im nächsten Gang erfolgreich ist. Ein Widerspruch muss gründlich vorbereitet sein. Das heißt für Sie: Fordern Sie Arztbriefe, Atteste, Entlassungsberichte ein, um die Pflegebedürftigkeit der betroffenen Person zu verifizieren. Auch ein tägliches Pflegetagebuch kann bei den Bewertungspunkten zu dem Unterschied führen, der Ihnen den Pflegegrad 5 im Folgegutachten beschert.
Gut zu wissen: Innerhalb der vierwöchigen Frist reicht eine schriftliche Mitteilung an die Pflegeversicherung, dass Sie gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch einlegen. Hier müssen Sie noch keine Gründe angeben. Anschließend haben Sie deutlich länger als die vier Wochen Zeit, den Widerspruch gut vorzubereiten.
VII. Änderungen 2025
Im Jahr 2025 werden sich einige Änderungen in Bezug auf die Leistungen für Pflegegrad 5 ergeben. So werden beispielsweise die Leistungsbeträge für ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflege erhöht. Diese Erhöhung soll dazu beitragen, die steigenden Kosten in der Pflege besser abzudecken. Eine weitere Anhebung der Leistungsbeträge, orientiert an der Kerninflationsrate der letzten drei Kalenderjahre, ist für Januar 2028 geplant. Diese regelmäßigen Anpassungen sollen sicherstellen, dass die Leistungen der Pflegeversicherung mit den wirtschaftlichen Entwicklungen Schritt halten und Pflegebedürftige sowie ihre Angehörigen weiterhin angemessen unterstützt werden.
Leistungsbeträge
Ab dem 01.01.2025 erhalten pflegebedürftige Personen mit Pflegegrad 5 mehr Pflegegeld. Auch die Beträge der Pflegesachleistungen werden angehoben. Welche Leistungen die Pflegekasse zahlt, hängt maßgeblich davon ab, ob eine pflegebedürftige Person zu Hause oder dauerhaft stationär versorgt wird. Außerdem steigen mit steigendem Pflegegrad in der Regel auch die Leistungen.
Ab Januar 2025 wird eine Erhöhung der Leistungsbeträge (ambulant, teil-/vollstationär) umgesetzt. Eine weitere Anhebung entsprechend der Kerninflationsrate der letzten drei Kalenderjahre ist für Januar 2028 geplant.
Ab dem 01.01.2025 besteht mit Pflegegrad 5 in der häuslichen Versorgung in der Regel Anspruch auf folgende Geldleistungen:
| Leistung ab dem 01.01.2025 | Was steht mir mit Pflegegrad 5 zu? (Maximale Leistung) | Intervall | Hinweis |
| Pflegegeld | 999,- € | Monatlich | Frei verfügbar |
| Pflegesachleistungen | 2.299,- € | Monatlich | Zweckgebunden |
| Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 42,- € | Monatlich | Zweckgebunden |
| Verhinderungspflege | 1.498,50 € – 1.685,- € | Jährlich bis zu 6 Wochen | Zweckgebunden |
| Kurzzeitpflege | 1854,- € | Jährlich | Zweckgebunden |
| Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | Max. 4180,- € | Je Maßnahme | Zweckgebunden |
| Entlastungsbetrag | 131,- € | Monatlich | Zweckgebunden |
| Wohngruppenzuschlag | 224,- € | Monatlich | Zweckgebunden |
| Tages- und Nachtpflege | 2.085 € | Monatlich | Zweckgebunden |
| Digitale Pflegeanwendungen und ergänzende Unterstützungsleistungen (DiPA) | 53,- € | Monatlich | Zweckgebunden |
Bei den in der Tabelle angegebenen Werten handelt es sich zum Teil um Maximalbeträge. Die genaue Höhe der Zahlungen für Menschen mit Pflegegrad 5 ist letztlich auch von der individuellen Situation abhängig. Mit Pflegegrad 5 besteht aber ein grundsätzlicher Anspruch auf die oben genannten Leistungen, unabhängig der Höhe. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Aspekten haben Personen, die bereits Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, gegenüber der Pflegekasse einen gesetzlichen Anspruch auf eine Pflegeberatung.
VIII. Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Pflegegrad 5 die höchste Stufe der Pflegebedürftigkeit darstellt und Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung betrifft. Um diesen Pflegegrad zu erhalten, ist eine umfassende Begutachtung durch den Medizinischen Dienst erforderlich, der die individuellen Einschränkungen und den Hilfebedarf bewertet. Personen mit Pflegegrad 5 haben Anspruch auf ein breites Spektrum an Leistungen, darunter Pflegegeld, Pflegesachleistungen, teilstationäre und vollstationäre Pflege, Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag sowie Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassungen. Diese Leistungen sollen eine bestmögliche Versorgung und Unterstützung im Alltag gewährleisten und pflegende Angehörige entlasten. Trotz der Herausforderungen, die mit einer so hohen Pflegebedürftigkeit einhergehen, ermöglichen die vielfältigen Angebote der Pflegeversicherung ein würdevolles Leben und eine individuelle Betreuung.
Zusammenfassung
Pflegegrad 5 ist die höchste Stufe der Pflegebedürftigkeit und wird Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung zuerkannt. Umfassende Unterstützung ist in nahezu allen Lebensbereichen notwendig, weshalb Betroffene Anspruch auf vielfältige Leistungen haben. Diese Leistungen umfassen sowohl finanzielle Hilfen wie Pflegegeld und Pflegesachleistungen als auch Zuschüsse für Wohnraumanpassungen, Pflegehilfsmittel und die Inanspruchnahme von Kurzzeit- oder Verhinderungspflege. Ziel ist es, eine bestmögliche Versorgung im häuslichen Umfeld oder in einer stationären Einrichtung zu gewährleisten und pflegende Angehörige zu entlasten.
Häufige Fragen
Personen mit Pflegegrad 5 haben Anspruch auf unterschiedliche Leistungen. Im Vergleich zu anderen Pflegegraden stehen Menschen mit einem Pflegegrad 5 aber die höchsten Leistungssätze zu.
In der Regel erhalten Menschen mit stark eingeschränkter Alltagskompetenz Pflegegrad 5. Häufige Beschwerden sind zum Beispiel Demenz sowie Schluck- und Sprachstörungen. Gleichzeitig müssen die pflegebedürftigen Personen bei einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst eine Punktzahl von mindestens 90 erhalten, um offiziell den Pflegegrad 5 zu erhalten.
Personen mit Pflegegrad 4 haben ausgeprägte Einschränkungen bei der Bewältigung ihres Alltags. Diese sind bei Personen mit Pflegegrad 5 vergleichsweise ausgeprägter, wenn auch möglicherweise anderer Natur. Pflegegrad 5 beinhaltet gleichfalls besondere Anforderungen für die pflegerische Versorgung.
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Abhängig ist das von der Unterstützung, die die pflegebedürftige Person benötigt.
Mit der Pflegereform im Jahr 2017 wurden die Pflegestufen in das System der Pflegegrade überführt. Damit rückt statt des Zeitaufwandes für die Pflege die Selbstständigkeit der pflegebedürftigen Person in den Mittelpunkt. Soll heißen: Seit 2017 spielt es für die Beantragung von Leistungen keine Rolle mehr, wie viele Stunden eine Person Hilfe benötigt. Somit muss auch keine Tabelle mehr geführt werden.